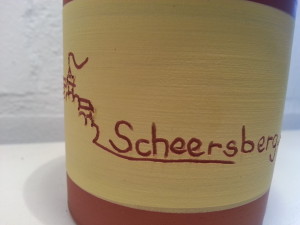 Am 5. September 2013 hatten Heiko Schulze (unser Spitzenkandidat) und ich einen interessanten Termin. Wir waren nach Scheersberg eingeladen, wo sich eine größere Gruppe von Schülern in einem Seminar mit Politik beschäftigt hat.
Am 5. September 2013 hatten Heiko Schulze (unser Spitzenkandidat) und ich einen interessanten Termin. Wir waren nach Scheersberg eingeladen, wo sich eine größere Gruppe von Schülern in einem Seminar mit Politik beschäftigt hat.
Schon am Vortage und im Laufe des Vormittags hatten mich die Schüler für kurze Telefoninterviews angerufen. Es ging um die Frage, wie viel Polizeigewalt bei Demos in Ordnung ist, um die Sicherheit zu gewährleisten, ob ich schon mal bei Demos war etc.
Spannend wurde es dann am Abend. 7 Parteien, 14 Kandidaten, ca. 100 Schüler.
Jeder Kandidat sitzt an einem Tisch und eine kleinere Schülergruppe sitzt dabei und stellt Fragen. Oder geht, wenn es nicht interessant ist, wieder zu anderen Tischen. Das Format ist spannend. Am Ende konnten Schüler Feedback-Zettel ausfüllen und die Kandidaten konnten diese mit nach Hause nehmen. Ich habe meine hier vor mir liegen. Aber bevor ich den Umschlag öffne, erst einmal mein Eindruck:
Ich habe zu viel geredet. Ich bin ein paarmal sehr oberflächlich geblieben. Aber ich war verblüfft, dass es viele Fragen zum bedingungslosen Grundeinkommen (mein Thema!) und zur Bildung (wirklich nicht mein Thema!) gab, doch keine zur Privatsphäre, Bürgerbeteiligung, Transparenz und zur NSA-Affäre.
Bis hierhin habe ich den Text am 5. September abends geschrieben. Nachdem ich jetzt die Feedback Zettel gelesen habe, musste ich zunächst die Überschrift ändern und dann hier im Text das Thema neu ausrichten. Denn es gibt Feedback Zettel, die ich sehr traurig fand:
“Ich finde Ihr Auftreten erfrischend ehrlich & es ist sicherlich auch sehr gut, Visionen für eine weniger auf Wirtschaft ausgerichtete Gesellschaft zu haben. Allerdings hätte ich mir mehr Positionen & Meinungen zu den Themen gewünscht, da ich denke, eine realitätsnahe Politik ist sonst nicht möglich.”
Und:
“schöne und sehr wünschenswerte Grundgedanken aber leider ein bisschen abgehoben und realitätsfern”
Diese beiden Zettel (und ich mag völlig falsch liegen) wirken auf mich wie Feedback zweier junger Menschen, die sich schon von den Richtlinien der Gesellschaft haben einschnüren lassen. Ist es wirklich so schwierig, sich vorzustellen, dass Menschen durchaus eine “Vision” haben können, ohne dass sie die Realität verleugnen?
Manchmal beobachte ich (öfter bei älteren) Menschen z.B. auch Unverständnis für das bedingungslose Grundeinkommen. Ich treffe manchmal auch auf eine sehr ausgeprägte Gläubigkeit an die hohe Fachkompetenz von Politikern (in welchem Fach eigentlich?). Vor allem aber sehe ich ein gefangenes Weltbild, welches sich zum Beispiel auf die große Menge an eigenen Erfahrungen stützt, oder durch Umgang und Umfeld schon sehr prägend gezeichnet wurde. Das wir alle im Laufe unseres Lebens unsere eigene Welt und unsere eigene Weltsicht formen, steht für mich außer Frage. Aber in jungem Alter? Es sind die merkel’schen / neoliberalen / kommerz-mainstream-getriebenen Sprechblasen, die sich tief eingeprägt haben.
Hier ein Gegenbeispiel: Auf einem Infostand, wo wir Unterschriften gegen das Fracking sammelten, sagte eine über 80-jährige Passantin zu mir, dass sie sich für ihre Kinder, für ihre Enkel erhebe. Wasser sei Grundrecht, Fracking gefährlich und wenn ihre Kinder das schon nicht verstehen würden – sie würde kämpfen. Sie sagte, wer, wenn nicht sie, mit ihrem Alter und ihrer Erfahrung könnte so etwas auch glaubwürdig vertreten. Dieses Weltbild zeugt von langer Erfahrung und hat sie zu einem interessanten Schluss kommen lassen.
Doch zurück nach Scheersberg. Was hat 17-20-jährige bereits so beeinflusst, dass sie schon jetzt von “Realitätsferne” sprechen und eine “realitätsnahe” Politik als alternativlos bezeichnen? In diese gleiche Kerbe schlägt auch die Frage, welche Koalition die Piraten denn eingehen würden. Als ich erklärte, dass ich eine Koalition der Themen bevorzugen würde, erntete ich auch nur ein müdes Lächeln.
Helmut Schmidt hat uns alle einen Bärendienst erwiesen, als er sagte “Wer eine Vision hat, der soll zum Arzt gehen.” Wann immer jemand heute bereit ist Gedanken zu formulieren, die gesellschaftlich weit über ein Vierjahresfenster hinausgehen, wird er zwangsläufig mit dieser Aussage konfrontiert.
Und nun die interessante Frage:
Warum sollte die Tatsache, dass jemand von einer bestimmten Gesellschaftsform träumt, ausschließen, dass er die Realität kennt? Ist es nicht eher so, als dass wir nur dann unsere Gesellschaft weiter entwickeln werden, wenn wir wissen, wohin wir wollen?
Das ist die Frage, an der sich jede “realpolitische” Entscheidung messen lassen muss: Was bringt es für unsere Entwicklung, wie bringt uns diese Entscheidung weiter auf dem Weg… wohin eigentlich?
Und um diese gesellschaftliche Frage geht es. Und wir Piraten stellen sie. Wir sind die mit den Fragen!
PS:
Ich möchte noch auf 2 weitere Feedbackzettel eingehen:
“Abgesehen von Computerthemen, war es schwer Informationen über andere Themen zu erhalten.”
Hierzu erlaube ich mir anzumerken, dass an meinem Tisch Computerthemen (leider) keine Rolle spielten. Ich sagte allerdings einmal, dass ich mich beruflich mit Computern auseinander setze. Und – wenn ich mich richtig erinnere – sprach ich mal von den der Integration des Internets in unseren Alltag. So etwas als “Computerthema” zu bezeichnen ist interessant… 😉
“sehr abschweifend, wenig qualifizierte Information, schlecht strukturiert”
Hierzu kann ich nichts weiter sagen, als dass ich mir das zu Herzen nehmen werde. Danke!
